Ich (Normen) erlebte vor einiger Zeit eine Situation, in der eine Großmutter beim Betrachten eines Fotos ihres Enkels Folgendes äußerte: „Das ist aber ein schönes Foto!“ In diesem Moment wurde mir klar, dass die Großmutter nicht das Foto schön fand, sondern nur das Motiv. Aus dem schönen Motiv wurde ein schönes Foto.
Mir stellte sich dann die Frage: Kann man eigentlich in der Beurteilung von Fotografien eine Grenze zwischen dem Foto als Endprodukt und dem Motiv ziehen? Sicherlich, denn nicht jedes gute Motiv führt am Ende zu einem guten Foto. Wenn es so etwas wie ein gutes Motiv geben sollte, können dann dennoch gute Fotos aus einem scheinbar schlechten Motiv entstehen?
Ich möchte einfach mal die Runde eröffnen und frage Euch: Welche Voraussetzungen muss ein gutes Motiv erfüllen?
Martin: Ich finde es persönlich sehr schwer, ein gutes Motiv als solches zu definieren, denn so löse ich es zu sehr aus dem Kontext, in dem es steht. Ein Würfel mit einem Meter Kantenlänge wirkt vor einem großen Wasserfall ganz anders als in einem weißen Raum – und das ganz ohne Wertung. Außerdem spielen hier vor allem unsere kulturell und familiär geprägten Präferenzen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Und wie im obigen Beispiel zu erkennen, kann das einfach nur auf der Beziehungsebene passieren. So viel zur Theorie.
In der fotografischen Praxis auf der Straße erlebe ich jedoch täglich, wie ich aktiv selektiere. Wen fotografiere ich und wen nicht? Für mich sind meistens die Menschen am interessantesten (= ein gutes Motiv), die aus der Masse herausstechen und ungewöhnlich im Rahmen des Gewöhnlichen auf meine Sehgewohnheiten wirken.
Robert: Ein Foto kann technisch gut umgesetzt, aber inhaltlich banal sein und umgekehrt ist natürlich ein auffälliges Motiv allein noch kein Garant für ein gutes Foto.
Darüber, was ein Motiv sein kann, entscheidet zunächst einmal der Fotograf. Seine Motivation mag ein persönlicher Bezug zu dem sein, was er fotografieren möchte. Wer das Foto anschließend betrachtet, kann allerdings eine ganz andere Sichtweise haben, weil er eine andere oder vielleicht gar keine Beziehung zum Motiv hat. Insofern stelle auch ich es mir sehr schwierig vor, ein Foto und sein Motiv nach objektiven Gesichtspunkten als gut zu beurteilen.
Sebastian: Mit dieser allzu subjektiven Ebene wäre ich vorsichtig, Robert. Ein gutes Foto ist ein gutes Foto, ich glaube schon, dass man das halbwegs objektiv bewerten kann. Das Motiv ist einerseits eine ganz andere Ebene, andererseits aber auch nicht vom Bild zu lösen.
Ich denke da immer an Literatur bei dem Kontext. Die besten Bücher sind oft die, in denen oberflächlich gar nicht viel passiert und sich die Handlung eher in Gedanken und Assoziationen abspielt und sich um Dinge dreht, die jeder kennt wie etwa Liebe und Tod.
Soll heißen: Ich denke, das Motiv muss gar nicht spektakulär oder außergewöhnlich sein, um es in einem überraschenden und neuen Kontext zu zeigen, der beim Betrachter viel mehr auslöst als ein totales Actionsuperdupermotiv, das langweilig fotografiert ist. Insofern würde ich fast sagen: Eher banale Motive ergeben oft die stärksten Bilder, wenn sie gut fotografiert sind.
Normen: Da fällt mir sofort Andreas Gursky und seine Fotografie „99 cent“ ein. Vollgepackte Regale in einem Supermarkt würden die meisten Fotografen vermutlich nicht als lohnenswertes Motiv in Betracht ziehen. Gursky tat es und es entstand eine der berühmtesten Fotografien der Welt.
Ich würde deshalb sagen, dass, wenn in der Fotografie vom Motiv gesprochen wird, allein der Fotograf entscheiden kann, ob es gut ist oder nicht. Ohne eine positive Abwägung des Fotografen ist die Entstehung eines guten Fotos nicht möglich.
Martin: Moment mal. Im Falle des reinen Fotoliebhabers, der aus reiner Zuneigung zu seinem Sujet fotografiert, mag das stimmen. Steigen wir jedoch mal in die professionelle Ebene ein, in der Kunden ein ganz bestimmtes Motiv in einem ganz bestimmten Kontext haben. Dann entscheidet eben nicht mehr der Fotograf allein, was gut ist und was nicht. Und im Ernstfall gibt es eben keine Kohle.
Und wenn wir jetzt mal einen Schritt zurück gehen und noch einmal den Fotoliebhaber ansehen, dann hat auch er einen Kunden, denn niemand (bis auf ein paar Ausnahmen) fotografiert nur für sich. Jede und jeder hat eine Absicht und jeder möchte irgendetwas erreichen. Und sei es selbst eine schockierte Ablehnung seitens der Betrachter. Wenn der Fotograf oder die Fotografin exakt das erreichen wollte, dann war das Foto – und somit auch das Motiv – gut.
Sebastian: Sehe ich überhaupt nicht so. Da kommen wir aber jetzt schnell an die Trennung von künstlerischer und kommerzieller Fotografie und wie (wenn überhaupt) das am Ende wirklich gut zusammengeht. Im Gegenteil ist es meiner Meinung nach gerade in der künstlerischen Fotografie so, dass man den „Kunden“ (in dem Fall das Publikum oder die Galerie oder den Sammler) beim Machen des Bildes so weit wie möglich außen vor lassen sollte. Wenn Du Dein Publikum schon im Entstehungsprozess mit reinrechnest, dann geht das leider oft übelst daneben.
Bei der kommerziellen Fotografie ist es dann genau anders herum. Du kriegst Dein Motiv vorgegeben (oder hast ein Motiv, das Du immer fotografierst und von dem Du weißt, dass es das Publikum kauft) und tobst Dich eben anderweitig kreativ aus. Aber braucht ein gutes Foto jetzt eigentlich auch ein gutes Motiv? Ich denke das immer noch nicht, für mich kann man aus jedem Motiv ein gutes Foto machen.
Normen: Ich fasse das mal kurz zusammen: Wir müssen in unserer Diskussion zwischen verschiedenen Grundlagen der Beurteilung unterscheiden. Zum Einen gibt es einen Unterschied zwischen künstlerischer und kommerzieller Fotografie und zum Anderen die unterschiedliche Beurteilung des Motivs durch Fotograf und Betrachter.
Deshalb könnte man jetzt wieder den Geschmackshammer rausholen und die Diskussion an dieser Stelle beenden. Machen wir aber nicht, denn in der Beurteilung eines Fotos kann es meiner Meinung nach eigentlich immer nur eine Person geben: Den Betrachter, unabhängig davon, ob er Kunde, Fotograf oder was auch immer ist. Es kann ja schließlich nicht das Ziel sein, ein Foto für allgemeingültig gut zu erklären.
Wie ist das bei mir? Wenn ich ein Motiv nicht mag, dann kann die Fotografie zwar technisch sehr gut sein und ich kann auch der Allgemeinheit zugestehen, es gut zu finden, persönlich lasse ich es aber nicht an mich heran und demnach würde es bei mir auch nicht in die Kategorie „gut“ fallen.
Robert: Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, weshalb man fotografieren sollte, was man nicht mag. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
Selbst, wenn es sich um einen schwierigen Auftrag handelt, muss man sich auf irgendeiner Ebene einen Zugang verschaffen, sonst produziert man doch für die Mülltonne und zur eigenen genauso wie zur Unzufriedenheit des Kunden.
Um mal auf die Beurteilung der Fotos zurückzukommen: Ich denke, man sollte im Blick haben, welchen Zweck das Bild erfüllen soll. Irgendeine Referenz braucht es für die Beurteilung doch immer, denn genauso wie ein Mensch ist auch ein Foto keine Insel.
Was mich sehr interessiert, ist, zu betrachten, wie und warum manche Bilder sich medial rapide ausbreiten und kollektiv anklingen.
Sebastian, was in Bezug darauf Deinen Standpunkt einer möglichen objektiven Bewertbarkeit angeht, möchte ich gern ein Beispiel für ein kollektiv als gut befundenes Bild herbeiziehen.
Manch einer kennt es sicher, die Rede ist von der Vogelperspektive von Iwan Baan hinunter auf das nächtliche Manhattan nach dem großen Sturm im vergangenen Jahr. Während die umliegenden Teile der Stadt noch aufleuchten, liegt der vordere Teil der Halbinsel aufgrund eines massiven Stromausfalls im Dunkeln.
Warum hat dieses Bild solch eine Durchschlagkraft entwickelt? Die Ursache liegt sicherlich darin, dass sich diejenigen, die es gesehen haben, sofort in irgendeiner Weise damit identifizieren konnten. Sagen wir, es ist vielleicht die natürliche Angst von uns Menschen vor dem Untergang oder vor etwas, das stärker ist als wir.
Das Foto hat also einen unverkennbaren Symbolcharakter, vielleicht auch, weil es schon vielmals vorher fotografiert wurde. Aber eben noch nie so und in diesem Zusammenhang.
Es ist unbestreitbar ein gutes Foto, weil es etwas anklingen lässt, was im kollektiven Gedächtnis steckt. Ich wäre hier dennoch vorsichtig, denn Konsens im kollektiven Gedächtnis lässt sich allzu leicht mit Objektivität verwechseln.
Genauso wie die Entscheidung für ein Motiv höchst subjektiv ist, bleibt meiner Meinung nach auch die Betrachtung und Beurteilung des Fotos eine höchst subjektive Angelegenheit.
Martin: Und ist genau diese Spannung nicht das, was es heute so schwer macht, zu beurteilen, was ein gutes Foto ist? Dieses Alles-oder-nichts? Die vielen verschiedenen Faktoren? In diesem Chaos wird es immer schwer bleiben, ein Foto und auch ein Motiv nach gut oder schlecht zu kategorisieren. Ich denke, wir sind in diesem Gedankenkarussell nicht allein, denn es wird sicher vielen anderen, die fotografieren so gehen wie uns.
Ein wichtiger Maßstab ist jedenfalls – und daran hat sicher niemand einen Zweifel – der eigene Geschmack. Doch mit jedem weiteren Maßstab, der unvermeidlich dazukommt – sei es nun ein Kunde, die Verwandtschaft oder die Community des Internets – wird es um ein Vielfaches komplexer.
Jedoch ist meiner Meinung nach ein einziger dieser Maßstäbe nicht per se als der entscheidende zu betrachten, denn immer dann fallen wir vom Pferd in die Drecksgrube namens Pauschalisierung, die stets ein Stück Kuchen für das ganze Ding hält.
Es kommen stets viele Faktoren zusammen und dazu gehört eben auch (nicht nur) das Motiv. Das Motiv entscheidet, was im Bild zu sehen sein wird und der Fotograf entscheidet, wie es zu sehen sein wird.
Robert: Aber machst Du denn ein Foto immer erst dann, wenn Du vorher abgewogen hast, ob es gut sein könnte? Da wirste ja verrückt! Ich denke, man muss einfach Lust auf das haben, was man fotografiert, das reicht schon völlig aus.
In sofern gebe ich Dir mit dem Geschmack ein bisschen recht, Martin, obwohl ich es lieber Interesse nennen möchte. Ob das eigene Interesse dann mit Bildern des kollektiven Gedächtnisses deckungsgleich ist (vorausgesetzt, dass einem das überhaupt wichtig ist), ist eine andere Frage – eine der richtigen Intuition.
Sebastian: Ich mache eigentlich auch die Bilder immer erst, wenn ich vorher abgewogen habe, ob es gut werden könnte, Robert. Ich verstehe aber auch die andere Richtung. Aber rumlaufen und Motive „entdecken“ und dann erst einmal überlegen und werten, ob und wie das ein gutes Bild sein könnte, egal, ob man einen persönlichen Bezug dazu hat oder nicht, gehört für mich auf jeden Fall zum Fotografieren dazu.
Vielleicht ist diese Motivauswahl auch eine gute Art, um der Ausgangsfrage näherzukommen: Vielleicht braucht ein gutes Foto ja nicht unbedingt ein gutes Motiv, aber einen Fotografen, der sein Motiv sehr gut aussucht.
Da kann man natürlich so Konsensmotive nehmen, die immer gehen (Katzenbabies!) und hat dann sicher ein populäres Foto, das sich weit verbreitet, aber ein gutes Foto ist es deswegen ja noch lange nicht, um auf dieses Manhattan-Bild zurückzukommen.
Mir sagt das irgendwie nicht viel, mal davon abgesehen, dass es natürlich ‘ne tolle Perspektive ist und es auf dem Cover mit der Typografie schick aussieht und journalistisch sicher eindrucksvoll ist. Aber ist das ein gutes Foto? Ich weiß nicht. Es ist eher so ein Kleinster-gemeinsamster-Nenner-Foto der Zeitgeschichte.
Normen: Mich haut das Manhattan-Foto auch nicht aus den Latschen, aber in dem Bewusstsein des ereignisreichen Zusammenhangs ist es durchaus ein gutes Foto. Das unterstreicht, dass ein gutes Foto oftmals mehrere Dinge braucht. Manchmal sagt uns das Motiv nichts oder es erscheint auf den ersten Blick trivial, sobald aber eine Entstehungsgeschichte bekannt ist, kann das Motiv eine interessante Wirkung auf den Betrachter haben.
Auf die gleiche Weise kann sich die Beurteilung eines Fotos auch im Laufe der Zeit verändern. Ein Foto, welches heute eher unbedeutend erscheint, kann für nachfolgende Generationen ein wichtiges Foto sein.
Am Ende steht auch hier der Betrachter und dieser kann im Laufe der Zeit ein und dasselbe Foto unterschiedlich bewerten. In meinen Augen zeigt das, wie schwierig es ist, ein Foto oder Motiv für gut oder schlecht zu halten.
Robert: Ganz genau.
Martin: Werden wir doch mal praktisch: Was ist für Euch ein schlechtes Motiv? Der Titel unserer Diskussion baut ja ein wenig darauf auf, was ein gutes Motiv ist.
Sebastian: Ich würde spontan sofort antworten: Jedes Motiv kann ein schlechtes Motiv sein, sofern der Fotograf keinen eigenen Bezug dazu hat. Das widerspricht natürlich erst einmal total der „Fotografie ist Handwerk“-These, aber ich denke wirklich, dass sich Gleichgültigkeit oder gar Widerwillen gegenüber einem Motiv auch in der Qualität der Arbeit widerspiegeln. Das ist die emotionale Seite.
Objektiv schlechte Motive sind meiner Meinung nach dagegen die, die schon eine Milliarde mal von allen Ecken und Enden abfotografiert wurden und eben die, bei denen das Motiv selbst eher der Star ist, weil es eben so geformt ist, wie es geformt ist oder an sich toll aussieht. Das objektiv schlechteste Motiv überhaupt ist für mich zuerst einmal ein anderes Foto ohne jeden Kontext, danach ein anderes Kunstwerk, das neutral abgelichtet wurde, dann irgendein Bauwerk, bei dem das Bauwerk der Eyecatcher ist. Generell vielleicht Dinge, in die der Fotograf selbst nichts reinlegt.
Robert: Damit, dass sich emotionale Gleichgültigkeit gegenüber dem Fotografierten auch im Ergebnis abbildet, gehe ich sofort mit, Sebastian.
Verbundenheit zum Fotografierten ist bei einem künstlerischen Ansatz vielleicht besonders wesentlich (weil es eben um die eigene Vision von etwas geht), aber sie ist auch für eine gute kommerzielle Arbeit essentiell.
Auf Deine Frage, Martin, antworte ich: Ein Motiv kann nicht an sich gut oder schlecht sein. Ich würde eher weiter gehen und sagen, dass es entweder eins ist oder eben keins, je nachdem, ob man für sich (aus der Perspektive des Fotografen bei der Aufnahme) in der Lage ist, einen Bezug herzustellen.
Ich denke, die Grundbedeutung des Begriffs Motiv in Malerei und Fotografie als dem Gegenstand des Bildes ist zudem ein wenig zu stark auf das fertige Bild und die Perspektive des Betrachters eingestellt und zu wenig auf die des Bildschöpfers.
Nicht zuletzt sind der Bezug des Fotografen zum Fotografierten und das Warum grundlegend für das Bild. Der Fotograf ist gewissermaßen Täter und weil die Entscheidung, das Foto zu machen stattgefunden hat, existiert es.
Nicht nur was abgebildet ist, sondern auch warum, ist eigentlich das Motiv.
Und ob es gut oder schlecht ist, wer soll das glaubwürdig beurteilen?

kwerfeldein – Fotografie Magazin























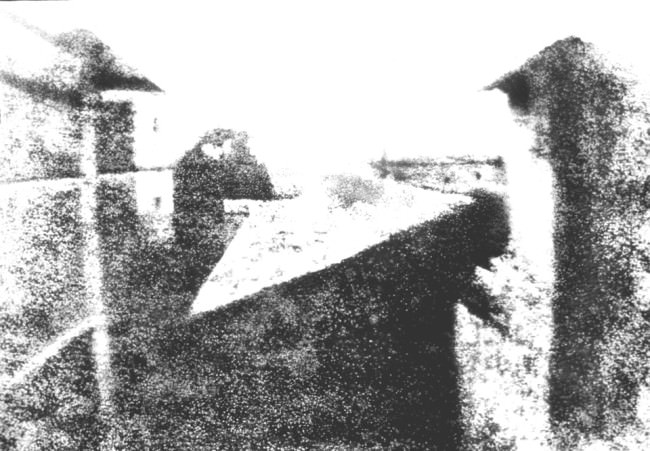
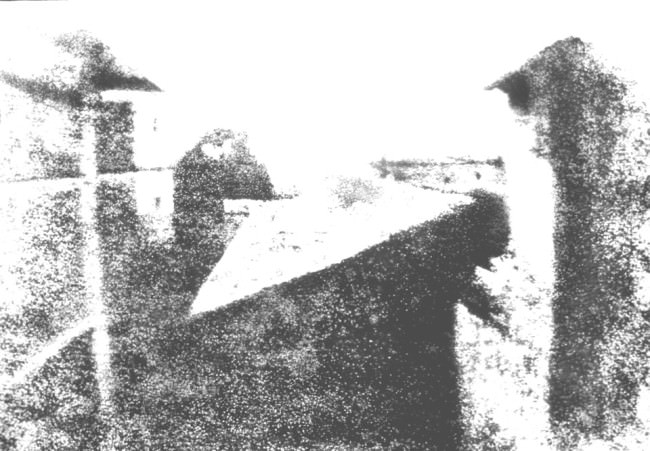
















You must be logged in to post a comment.