Ein Beitrag von: Mike Peters
Die Fotografie hat mein Leben gerettet, als ich noch ein Teenager war. Sie gab mir etwas, in das ich eintauchen konnte und eine Rechtfertigung dafür, draußen in der Welt zu sein. Herumzugucken, zu glotzen und schließlich Menschen zu treffen. Über mich selbst etwas zu lernen.
Die Fotografie gab mir außerdem eine Stimme in einer Zeit, in der ich keine Stimme hatte. Sie war ein Mittel, um zu zeigen, wie ich die Welt sah. Und mit meinen Gefühlen verbunden zu sein, die ich dann in den Aufnahmen ausdrückte.
Ich fühlte mich allein, einsam und hatte kein Selbstvertrauen. Das Fotografieren war für mich dann sowohl Flucht als auch Rettung.

In der Hochschul-Bibliothek brütete ich über Fotomagazinen und las alles Mögliche von Kameras, über Objektive bis hin zu allen möglichen Techniken. Über die Fotografien selbst wurde nur wenig geschrieben und über die Beweggründe der Fotografen auch nicht. Es ging nur um Grundlagen und Kleinkram.
Dann fand ich die Arbeiten von Robert Frank, W. Eugene Smit, Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, Robert Cape, Brassaï, McCullin, Andre Kertesz, Diane Arbus, Richard Avedon, Dorothea Lange und vielen anderen, die zu meiner Inspiration wurden.
Ich wusste nicht, was ihre Arbeit so gut machte, aber ich wusste, dass das, was ich beim Anblick der Bilder fühlte, mehr war als nur visuelle Freude. Es war tiefer und komplexer.
Wenn ich daran zurückdenke, waren alle Bilder, die für mich in den frühen Jahren wichtig waren, schwarzweiß. Jahrelang habe ich persönliche Projekte mit 35mm-Schwarzweißfilm durchgeführt, aber wenn ich mir diese nun ansehe, fühlen sich die meisten trivial an. Denn alle meine Arbeiten, die ernstzunehmen sind, sind in Farbe entstanden.

Ich bin mir nicht wirklich sicher, was ich daraus schließen soll, aber mir ist klar, dass ich vielleicht zu verkrampft versuchte, „wichtige“ Fotos zu machen, anstatt mehr Zeit in meine eigenen Interessen zu investieren und meinem Herz zu folgen.
Was ich damals noch nicht wusste: Ich musste mehr erleben, um zu herauszufinden, was für mich wichtig ist. Um eine eigene Meinung über die Welt zu haben und eine große Leidenschaft zu spüren, bevor ich jemals ein Foto mit Inhalt machen könnte.
Ich war zu sehr in die Fotografie verliebt, um ein guter Fotograf zu sein. Ich musste lernen, das Leben selbst mehr zu lieben.
Im College hatte ich gelernt, wie man eine 4×5-Großformatkamera benutzt. Mir gefiel die Schlichtheit des Prozesses und der schöne Anblick des Einstellbildes. Zusätzlich wurde mir klar, dass es eine besondere Herausforderung war, Menschen damit zu fotografieren. Denn ich war gezwungen, sehr genau zu planen, wen und was ich im Bild haben wollte.

Zuerst musste ich meine Furcht überwinden, Menschen zu fragen, ob ich ein Bild von ihnen machen dürfe. Weil es eine zeitlang dauerte, bis ich soweit war, konnten die Leute sich entspannen (ich auch) und schließlich setzten sie sich der Kamera aus.
Ich habe viele Jahre damit verbracht, die Straßen meiner Heimatstadt mit der Großformatkamera auf der Schulter abzulaufen. Ich traf Leute und fragte sie, ob ich sie fotografieren dürfe. Jedes mal war es fürchterlich für mich, Leute so anzusprechen, obwohl die Kamera selbst genügend Anlass zum Gespräch gab.
Die Signifikanz dieser frühen Aufnahmen ragt weit in mein Leben hinein und dennoch brauchte ich viele Jahre, um die Lehren zu verstehen, die sie mir vermitteln sollten.
Bis 2001 machte ich Portraits von Menschen mit der Großformatkamera. Doch dann interessierte ich mich mehr für eine spontanere Art und Weise, zu fotografieren. Außerdem fand ich die überzeugende Einfachheit des quadratischen Formates zunehmend spannend.

2002 wechselte ich dann zu 6×6-Filmkameras und begann, ungestellte Bilder von Menschen auf der Straße zu machen.
Das Quadrat hat mich kompositorisch befreit. Ich bin sehr vertraut mit seinen Begrenzungen und mag die Herausforderung, das Bild passend zu komponieren. Weil ich mich nicht mehr entscheiden muss, ob ich quer- oder hochformatig fotografiere, kann ich mich einfach auf das konzentrieren, was vor mir ist und wohin ich mich stellen muss.
So zu fotografieren ist für mich sehr intuitiv und das Quadrat sehr bequem. Es unterscheidet auch meine persönliche Arbeit von der, die ich für Kunden mache: Die ist stets rechteckig. Wenn ich heute das Quadrat sehe, muss beim Fotografieren das Bild nur mir gefallen.
Durch diesen Übergang von 4×5 zum Quadrat begann ich, meine frühen Fotografien neu zu studieren. Bald konnte ich verstehen, warum und was diese Aufnahmen in mir zum Schwingen brachten.

Ich machte ganz bewusste Entscheidungen betreffend der Menschen, die ich fotografierte und begann, zu sehen, dass jede Person etwas ganz Besonderes hatte, das mich ansprach. Sei dies ein Gesichtsausdruck oder ihre Körpersprache.
Von da an konnte ich meine Bilder weiter studieren und dieselben Verbindungen herstellen. Endlich hatte ich meine Stimme gefunden!

In diesem Jahr, 2013, habe ich damit angefangen, digital im Quadrat zu fotografieren, um meine Zeit produktiver zu nutzen. Ich bin mittlerweile soweit, dass das Equipment, das ich benutze viel unwichtiger ist als das Bild selbst. Technik und Gadgets sind nur insofern wichtig, als dass sie das Bild liefern, ansonsten sind sie nebensächlich.
Wenn ich mich jetzt in der Welt bewege, kann ich mich selbst in den Gesichtern der anderen erkennen, sie von der Masse unterscheiden und schnell einen Kontakt herstellen. Wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde.
Meine Bilder repräsentieren meine Suche nach universellen Wahrheiten des Lebens – im Gesicht der anderen. Meine Fotografien sind der Versuch, zu zeigen, dass ich hier war und sie bestätigen, dass die Fotografierten auch da waren. Alles, was ich anbieten kann, ist meine Perspektive.
Ich möchte einen Beweis hinterlassen, dass wir existiert haben. An diesem Ort, zu dieser Zeit. Meine einzige Hoffnung ist, dass meine Aufnahmen in den Herzen und Gedanken anderer etwas bewegen.

Im Jahrzehnt nach den Anschlägen in New York City am 11. September 2001, die ich von ein paar Meilen entfernt sah, versuchte ich, meine Gefühle über das, was ich gesehen hatte, zu sortieren. Ich schaute in die Gesichter der Menschen um mich herum und fotografierte, was ich in dieser Zeit des Übergangs und Aufruhrs sah und fühlte. Diese Arbeit trägt den Namen „The Dream“.
Ich habe mich immer gefragt, was aus dem amerikanischen Traum geworden ist – dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann. Ist das überhaupt realistisch und verfolgenswert? Ist der amerikanische Traum heute immer noch stimmig oder müssen wir unsere Erwartungen ändern?
Was ich weiß, ist, dass das Leben für viele Menschen, die ich täglich treffe sehr viel härter geworden ist. Und dennoch ist da die Hoffnung, dass die Dinge sich ändern werden. Auch ein Verständnis dafür, dass egal, wie hart es wird, wir uns glücklich schätzen dürfen, hier zu leben.
Seit 2011 arbeite ich an einem weiteren Projekt über eine Gegend in Manhattan, die der „Meatpacking District“ genannt wird. Früher was es dort dreckig, es stank und sah nachts und an Wochenenden total desolat aus. Der optimale Ort für eine wachsende Straßenprostitution und Bars zum Abstürzen.

Heute ist der Ort viel moderner geworden. High-End-Geschäfte, Restaurants und Clubs haben Schotter und Ruß durch Glanz und Glitzer ersetzt. Menschen aus aller Welt strömen in die Gegend, um eine gute Zeit zu haben.
Für dieses Projekt fotografiere ich nachts mit einem Blitz. Ich halte Menschen an, die ich interessant finde und frage, ob ich ein Bild machen darf. Ich ihren Gesichtern erkenne ich denselben verzweifelten Drang, Spaß zu haben, wie ich ihn als junger Mann hatte.

In den (geplanten) Unterhaltungen kann ich meistens Momente der Spontanität und Individualität entdecken. In diesen Sekunden, in denen ich wieder in Kontakt mit meinem Subjekt bin, wenn ich den Menschen meine Aufmerksamkeit für ihr Dasein gebe, teilen sie ihre kostbare Zeit mit mir und öffnen sich für den Prozess, von mir und Euch, den Betrachtern, gesehen zu werden.
Wie immer bin ich dankbar für die Menschen, die ich fotografiere, denn sie sind es, die mir eine Art Bestimmung geben, wenn ich einen kleinen Teil ihrer Geschichte erzähle. Und langsam aber sicher meine eigene herausfinde.

Die Fotografie hört nicht auf, mein Leben zu retten, hält mich jeden Tag in Kontakt mit Menschen, draußen in der Welt und ernährt mich. Ich bin dankbar für all die Gaben, die die Fotografie mir und meiner Familie gebracht hat. Ich bin in der Tat ein glücklicher Mensch.
Dieser Artikel wurde von Martin Gommel aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.

kwerfeldein – Fotografie Magazin



































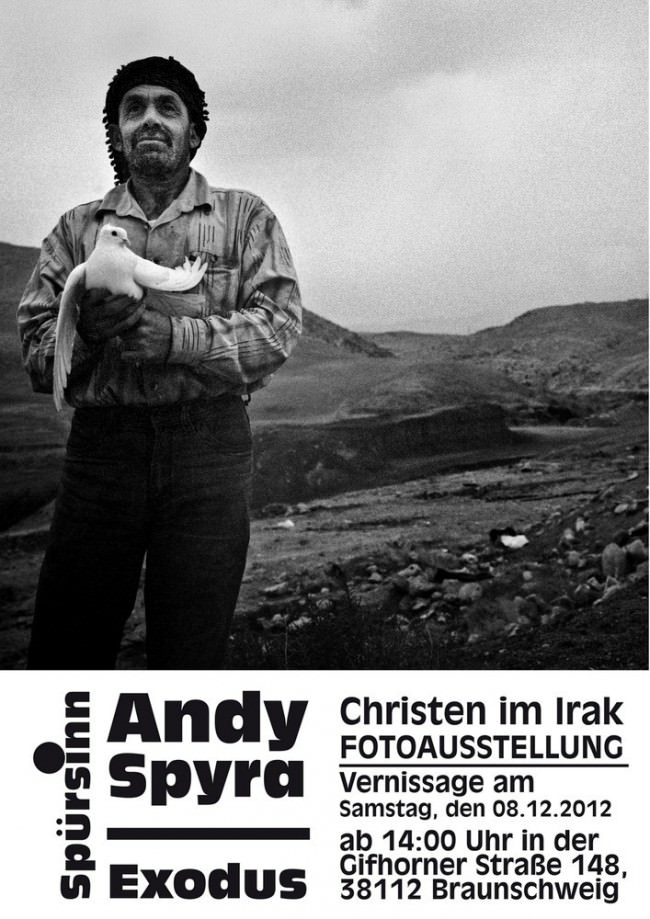










You must be logged in to post a comment.